Amazon-Partnerprogramm
Hinweis: Alle Amazon-Links sind Affiliate-Links. Das bedeutet, dass ich eine kleine Provision erhalte, wenn du auf den Link klickst und bei Amazon einkaufst. Das hilft mir, den Blogs zu finanzieren.
|
1. Teil der Ghostwalker-Serie
 Inhalt: Inhalt:
Die Journalistin Marisa Pérèz lebt nach einem Skandal zurückgezogen in den Bergen Kaliforniens. Eines Nachts findet sie einen verletzten nackten Mann auf ihrer Veranda. Sie nimmt sich seiner an und versorgt seine Wunden. Am nächsten Morgen steht die Polizei vor der Tür – in der Nachbarschaft wurde ein Mord verübt. Marisa ahnt nicht, dass der faszinierende Fremde ein Geheimnis hütet, das ihre Welt erschüttern wird …
Kommentar:
Die zufällige Rettung eines attraktiven Fremden verändert Marisas Leben, denn dadurch gerät sie in tödliche Gefahr und muss gemeinsam mit ihm flüchten. Als sie nach einigen Schwierigkeiten schließlich das Lager von Coyles Leuten erreichen, gerät ihre Weltvorstellung ins Wanken: Sie erfährt, dass Coyle und seine Leute Gestaltwandler sind – halb Mensch, halb Berglöwe (Puma) –, die von einem Unbekannten gejagt werden. Ein Junge namens Bowen wurde bereits entführt, und die Gestaltwandler setzen alles daran, ihn zu befreien. Dabei geraten Coyle und Marisa aber auch selbst ins Visier der skrupellosen Verbrecher.
Mit einigem Interesse habe ich dem ersten Teil der Ghostwalker-Serie entgegengeblickt, denn mit Michelle Raven wendet sich eine relativ bekannte deutsche Romantic-Suspense-Autorin dem Genre der paranormalen Liebesromane zu. Im Zentrum stehen Gestaltwandler, bei denen es sich allerdings ausnahmsweise mal nicht um Werwölfe handelt, sondern – vorwiegend – um Raubkatzen. Davon abgesehen bleibt sie aber ihrer Linie treu: Das Buch trägt sehr deutliche Romantic-Suspense-Züge – und bestätigt meinen früheren Eindruck, dass ich mit diesem Liebesroman-Sub-Genre herzlich wenig anfangen kann.
Ich erwarte von einem Liebesroman keine realisische Handlung, aber was hier geboten wird, ist mir einfach zu arg. Da schleppt die verschreckte Marisa, die ja keinem Menschen auf der ganzen Welt mehr trauen kann, einen verletzten Fremden in ihre Hütte, versorgt ihn und lässt ihn im Haus übernachten, statt Polizei und/oder Ambulanz zu rufen. Nicht viel später begibt sie sich mit ihm auf die Flucht, nur weil er ihr verkündet, sie befinde sich in Lebensgefahr. Dann müssen sie sich während der Flucht trennen, doch dank eines obskuren Adlers, der Marisa durch sein Verhalten zum Autodiebstahl anstiftet, kann sie Coyle nicht viel später doch wieder aufsammeln. Ein leerer Benzintank ist ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zum Lager von Coyles Leuten, ebenso wie die jeden Überlebensinstinkt überlagernde ständige und überwältigende Lust aufeinander. Zwar lauern überall Feinde, doch das hindert die beiden, die schon die ganze Zeit nervtötend heiß aufeinander sind, nicht daran, mitten in der Pampa übereinander herzufallen. Zwar schlafen die beiden nicht miteinander, aber immerhin Marisa kommt voll und ganz auf ihre Kosten.
Noch unglaublicher wird es, als die beiden schließlich das Lager erreicht haben, und sie schließlich erfährt, dass Coyle ein Gestaltwandler ist. Er hält sich nicht mit großartigen Erklärungen auf, sondern führt es ihr mit dem Hinweis, sie brauche keine Angst zu haben, einfach vor, indem er sich mal eben in einen Berglöwen verwandelt. Marisa ist für ein paar Sekunden schon ein wenig erschrocken, dann allerdings geht sie dazu über, seine vollkommene Schönheit zu bewundern, ihn zu kraulen und sich an sich zu schmiegen. Was soll ich sagen, daran, dass die beiden ununterbrochen heiß aufeinander sind, ändert auch die derzeitige Gestalt von Berglöwe Coyle nichts. Er baut sich also über ihr auf und leckt mit seiner raffinierten Raubtierzunge ihre Brüste, bis sie im Strudel ihres Höhepunkts versinkt. Marisas trockener Kommentar dazu: »Das war … ungewöhnlich. Wir sollten reden.« (S. 161). Ungewöhnlich ist wirklich ein gutes Stichwort! Als es nicht viel später endlich erstmals zum »echten« Vollzug kommt, hat Coyle zwar prinzipiell gerade seine menschliche Gestalt, Zunge und Zähne sind aber doch tierisch, außerdem hat er teilweise ein Fell. Ich staune ehrlich gesagt immer noch über diese m.E. sodomistisch angehauchten Szenen und finde es wirklich mutig, so etwas in diesem Buchsegment zu veröffentlichen – und noch mehr staune ich darüber, dass in kaum einem anderem Kommentar zum Buch darauf eingegangen wird. Dass Menschenfrauen, die sich mit Berglöwengestaltwandlern vereinigen, Berglöwenbabys zur Welt bringen, macht da auch schon nicht mehr viel aus.
Zur Kritik an der Handlung kommt, dass mich die Protagonisten gar nicht überzeugen konnten. Coyle bleibt relativ blass und gerät ständig in Lebensgefahr, aus der ihn Marisa retten muss, während Coyle nie zur Stelle ist, wenn sie ihn braucht (außer vielleicht sexuell). Marisa hadert mit ihrer Vergangenheit und handelt überhaupt nicht konsequent. Obwohl sie in einigen Situationen durchaus Mut und Stärke an den Tag legt, wirkt sie andererseits oft wie ein naives, oberflächliches kleines Mädchen. Ihre selbstzweiflerischen Anwandlungen – sie sorgt sich beispielsweise selbst nach dem heißesten Sex noch um ihre Augenringe, die möglicherweise ihre Attraktivität schmälern – sind aufgrund ihrer Unangemessenheit ziemlich anstrengend, und wie bereits mehrfach erwähnt ist die Sexfixierung der beiden Protagonisten selbst in schlimmsten Gefahren einfach nur unglaubwürdig und nervig.
Einen ansprechenden Nebenstrang bilden die Geschehnisse im Haus des besessenen Wissenschaftlers Stammheimer, der Jungberglöwengestaltwandler Bowen gefangen hält, um an ihm zu forschen. Interessant wird es, als Stammheimers eigentlich bei der Mutter lebende Tochter Isabel bei ihm aufschlägt, Bowen zufällig entdeckt und versucht, ihm zur Flucht zu verhelfen. Isabel und Bowen sind immerhin wesentlich sympathischer als Coyle und vor allem Marisa, wenngleich sie einige frappierende Gemeinsamkeiten mit den beiden aufweisen. Isabel reagiert zum Beispiel ebenso unfassbar gelassen auf die Verwandlung von Bowen in einen Berglöwen wie zuvor Marisa – sie schaut sich die Wandlung mit staunender Faszination an, krault die Raubkatze ein bisschen unterm Kinn und alles ist gut. Und als wäre es nicht schlimm genug, dass Marisa und Coyle nichts anderes im Kopf haben als immer nur Sex, kriegt auch Bowen, der an eine Liege gefesselt ist und tagelang gefoltert wurde, beim Anblick von Isabel unmittelbar eine Erektion – als hätte er sonst keine Probleme!
Stilistisch ist das Buch ebenfalls eigen. Michelle Ravens Erzählweise ist mir einfach viel zu ausufernd; sie breitet alles endlos aus und beschreibt jede Detail in einer Ausführlichkeit, die mich einfach nur gelangweilt hat. Man hätte »Die Spur der Katze« locker um 150–200 Seiten kürzen können, ohne dass man auf irgendwelche relevanten Inhalte hätte verzichten müssen – und es hätte dem Buch eher gut getan denn geschadet. Zugegebenermaßen ist das aber schlicht eine stilistische Eigenheit der Autorin, die der eine mag und der andere nicht.
Fazit:
5/15 – Sexbesessene Helden stolpern durch eine mit Gestaltwandlern angereicherte Geschichte, die jeder Logik entbehrt und auch noch so detailliert erzählt ist, dass sie trotz aller Action und Abenteuer langweilt. Freunde des Romantic-Suspense-Genres werden an dem Buch aber möglicherweise trotzdem ihre Freude haben.
 Inhalt: Inhalt:
Jede Beziehung hat das Zeug zur Satire. Schlafzimmer und Mann sind vorgeheizt, nur die Liebste lässt auf sich warten. Hatte er ihr nicht eine SMS mit »Erwarte dich auf dem Maträtzchen, mein Schätzchen« geschickt? Hoppla, die Nachricht ging versehentlich an eine Kollegin. Von wegen langweiliges Familienleben. Bei Stefan Schwarz haben alle was zu lachen. Er muss sich wegen memmenhafter Schreckhaftigkeit rechtfertigen, die Frau will im Bett noch nicht abgedimmt werden, der Sohn lügt zu schlecht, der Tochter gelingt in der Küche die Erstbesteigung der Abzugshaube, die verdammte Ossi-Katze hat immer was zu jammern und der irrlichternde Alt-Vater gerät mit rutschender Hose beinahe in eine Pressekonferenz mit Angela Merkel.
Kommentar:
Der vielversprechende Titel hat mich auf das Buch aufmerksam werden lassen – nur ist es blöderweise nicht so originell wie der Titel verspricht. Stefan Schwarz erzählt kurze Begebenheiten aus seinem Alltag, die mich zumeist einfach nur gelangweilt haben. Die einzelnen Episoden sind schlicht nicht pointiert genug, um einen gut zu unterhalten; ihnen geht trotz der Kürze (maximal vier Seiten) in den meisten Fällen auf halber Strecke die Luft aus. Zwar veranlasst die eine oder andere Formulierung und Situation zum Schmunzeln, das wars aber auch schon – und das reicht nicht. Um ehrlich zu sein hat mich das Ganze nach einer Weile so sehr ermüdet, dass ich nur noch weitergelesen habe, bis ich endlich auf die Episode gestoßen bin, auf die der Buchtitel verweist und die den weit weniger originellen Titel »Schnurren und Schrammen – wer will das verdammen« trägt. Nachdem aber selbst die mich nicht gut unterhalten konnte, habe ich beschlossen, das Buch abzubrechen. Mir geht offenbar der Humor ab, um dieses Buch so »urkomisch« finden zu können wie die meisten anderen Kritiker.
Fazit:
4/15 – Trotz netter Ansätze alles in allem total langweilig und belanglos. Dass ich das kleinformatige Buch trotz seines geringen Umfangs von nur 144 Seiten in der Mitte abgebrochen habe, spricht wohl eine deutliche Sprache.
Originaltitel: Light Boxes
 
Inhalt:
Viele hundert Tage schon währt die kalte Herrschaft des Februars: Der Wechsel der Jahreszeiten ist außer Kraft gesetzt, finstere Priester patrouillieren, Papierdrachen dürfen nicht mehr zum Himmel aufsteigen, Kinder verschwinden im Wald. Traurigkeit legt sich über die Stadt wie der Schnee, der endlos fällt, doch die Erinnerung an warme Tage lebt weiter. Die Stadt beschließt, in den Kampf zu ziehen, den Winter zu besiegen, und Thaddeus, der Ballonfahrer, soll ihr Anführer sein. Doch dann stößt Thaddeus in einer Hütte am Waldrand auf den Februar selbst – und es ist ein Mann, der eine Geschichte schreibt: die Geschichte der Stadt …
Kommentar:
»Thaddeus und der Februrar« ist ein ausgesprochen hübsches kleines Buch: kompakt, ansprechend gestaltet, typografisch interessant und mit sehr schönen Zeichnungen von Ria Brodell zu einzelnen Buchszenen. Zweifellos malt auch Shane Jones sehr anschauliche, lebendige Bilder und schafft vereinzelt wunderschöne, poetische Sätze. Das ist aber leider auch schon das beste, was ich über das Werk sagen kann.
Das Buch dürfte wohl der literarischen Moderne bzw. der experimentellen Literatur zuzuordnen sein. Es wird mit der Typografie gespielt, immer wieder sind Listen mit Aufzählungen eingestreut und es gibt Seiten, auf denen nur ein Satz steht oder ein einziger Satz wiederholt wird. Damit könnte ich mit gut arrangieren, wenn ich den Sinn der Geschichte verstanden hätte, doch Jones‘ Metaphorik erschließt sich mir nicht im geringsten. Wie der Pressetext offenbart, erzählt der Autor von etwas, »das tief in uns existiert«; ich weiß nur leider nicht, was das sein soll. Und nicht nur begreife ich den tieferen Sinn nicht, ich vermag nicht mal der vordergründigen Geschichte zu folgen. Dankenswerterweise erhellt einen der Klappentext einigermaßen, darüber hinaus ist die Story aber einfach nur verworren und fragementarisch; befremdliche, teils brutale Szenen reihen sich – oft zusammenhanglos – aneinander. Am Ende ist der mutmaßliche Februar gar nicht der Februar, sondern der echte Februar hat nur so getan als sei der falsche Februar der echte Februar … oder so. Sein Täschungsmanöver hilft ihm jedenfalls nichts, er wird von Thaddeus besiegt. Alles wird gut, die Toten sind gar nicht tot – vom Februar abgesehen –, und Juni und Juli halten Einzug. Es steht zu hoffen, dass die beiden weniger fiese Gestalten sind als der Februar, sonst gibts womöglich eine Fortsetzung.
Fazit:
Eindeutig nur etwas für Freunde experimenteller Literatur. Da ich trotz literaturwissenschaftlichen Studiums nichts begriffen habe und mich das Buch offenbar heillos überfordert, kann ich mich nur Thaddeus selbst anschließen, der im Gespräch mit dem falschen Februar feststellt: »Das ist doch alles Irrsinn« (S. 143).
 Inhalt: Inhalt:
Als der legendäre Pianist Luc d’Auber in Köln ein Konzert gibt, sieht die Journalistin Gardis Schönborn ihre Chance: Niemand hat je ein Interview mit ihm gemacht, und niemand weiß genau, wer er ist. Nur eins ist sicher: Seine Musik verzaubert eine eingeschworene Fangemeinde. Nach dem Konzert sucht d’Auber überraschend Gardis Hilfe und eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt. Gardis gerät ins Fadenkreuz eines geheimen Vampirjägerordens und steht vor einer schweren Entscheidung. Ist d’Auber der gesuchte Vampir von Melaten?
Kommentar:
»Der Vampir von Melaten« ist mein erster Regionalkrimi – und die vordringlichste Frage, die sich mir stellt, lautet: Gehört das eigentlich so, dass man in diesem Krimi-Sub-Genre mit Straßennamen, Namen von Plätzen, Bezeichnungen von Vierteln sowie Beschreibungen von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten zugeballert wird? Noch nie sind mir in einem Buch so viele detaillierte Wegbeschreibungen begegnet – die in dieser Ausführlichkeit überhaupt nichts bringen und damit mehr als überflüssig sind. Das liest sich dann wie folgt:
Am Glaskasten der Zentralbibliothek vorbei gelangte Gardis über den östlichen Rand des Neumarkts zur Schildergasse. Sie bog nach wenigen Schritten in die Krebsgasse ab, wandte sich dem Opernhaus zu und überquerten den Platz davor [der übrigens meines Wissens Opernplatz heißt, auf dem sich wiederum der Opernbrunnen befindet – die man beide aus unerfindlichen Gründen unbenannt bzw. unerwähnt gelassen hat; A.d.R.]. Die Tunisstraße, wo sie auf das Grün der Fußgängerampel warten musste, zerhackte die Innenstadt wie eine kleine Autobahn. (…) Die Ampel sprang auf Grün und als Gardis losging, sah sie hinter den Dächern die beleuchteten Domspitzen aufragen. Nachdem sie den winzigen Park bei der Minoritenkirche durchquert hatte, erkannte sie auf dem Wallrafplatz ein paar dunkle Gestalten, die wie sie Richtung Domplatte eilten. Unterhalb des Römisch-Germanischen Museums, auf dem alten römischen Hafenpflaster, sah sie sich von immer mehr Menschen umringt … (S. 78)
Das liest sich für meine Begriffe wie ein Reiseführer! Sollen solche ausufernden Schilderungen tatsächlich für regionales Flair sorgen und macht sowas einen Regionalkrimi aus? Ist es wirklich das, was die wachsende Leserschaft der Regionalkrimis an diesem Genre begeistert? Gibt es keinen weniger plumpen Weg, das Kolorit einer Stadt zu vermitteln? Mein Ding ist das überhaupt nicht, aber da ich während des Lesens permanent Gardis‘ Lauf- und Fahrwege gedanklich nachvollzogen habe, kann ich immerhin feststellen, dass sich keine größeren Fehler eingeschlichen haben und dass ich nun ein paar Straßennamen mehr weiß – das ist ja auch schon was.
Die Handlung an sich startet interessant. Die arbeitslose Journalistin Gardis ist auf der Suche nach einer großen Story, als sie einen alten Bekannten trifft, der ihr prompt ein Thema liefert: Er erzählt ihr von einem geheimnisumwitterten Pianisten, der jeden Kontakt zur Öffentlichkeit ablehnt und ein Konzert in der Philharmonie gibt. Gardis macht sich auf, um Informationen über Luc d’Aubert zu sammeln und stößt bald auf einen Kollegen im Ruhestand, der ihr eine höchst mysteriöse Geschichte über den Pianisten erzählt, aber wichtige Informationen zur Beschaffung einer Karte für das ausverkaufte Konzert vermittelt. Beeindruckt von der Musik d’Auberts intensiviert Gardis ihre Bemühungen, mehr über ihn herauszufinden, doch schließlich ist der Pianist es, der sie kontaktiert und sie um Hilfe bittet: Sie soll eine unbekannte Partitur finden, die ihm Erlösung bringen soll.
Gardis recheriert also vor sich hin, treibt sich auf dem geschichtsträchtigen Melatenfriedhof herum, beschreibt weiterhin ausufernd ihre Laufwege, Aufenthaltsorte und die Kölner Architekturhighlights, schildert in aller Ausfühlichkeit Räume und Szenen und stellt irgendwann mit erstaunlicher Gelassenheit fest, dass der wundervolle Luc ein Vampir sein muss. Aus unerfindlichen Gründen ist sie nicht viel später ganz plötzlich in flammender Liebe zu dem vollkommen profillosen und geradezu blutleeren Blutsauger entbrannt und befindet sich zudem in den Fängen eines Vampirjägerordens, der Luc vernichten will, dem sie aber trotzdem fröhlich alle möglichen Details über den Vampir offenbart – was schließlich in einem ziemlich fantastischen, surreal anmutenden Kampf gipfelt. Das Ende setzt der Geschichte dann endgültig die Krone auf und bietet darüber hinaus Potenzial für eine Fortsetzung, die aber definitiv ohne mich stattfinden wird.
Fazit:
5/15 – Eine Geschichte, die trotz der viel zu ausführlichen Beschreibungen Kölscher Begebenheiten eigentlich gut startet, dann aber immer abstruser wird und mich von Seite zu Seite mehr verärgert hat.
Originaltitel: Meridian
1. Band der Fenestra-Serie
 
Inhalt:
Wenn kleine Tiere spüren, dass der Tod nah ist, suchen sie Meridians Nähe, um an sie gekuschelt zu sterben. Das war schon immer so, seit Meridian geboren wurde, und sie macht sich längst keine Gedanken mehr darüber. Doch an ihrem 16. Geburtstag ist plötzlich etwas anders: Als vor Meridians Haus ein schwerer Unfall passiert, empfindet das Mädchen den Schmerz der Sterbenden am eigenen Leib – und entgeht selbst nur knapp dem Tod. Jetzt erst erfährt sie die Wahrheit: Sie gehört zu den Fenestras, die den Seelen der Verstorbenen das Fenster zum Himmel öffnen können. Ihre Gabe ist nun voll erwacht und bringt Meridian in größte Gefahr, denn die Fenestras haben dunkle Gegenspieler …
Kommentar:
»Meridian« ist ein weiteres All-Age-Fantasy-Romance-Buch einer noch jungen Autorin, das überall so hoch gelobt wird, dass ich mich zum Lesen entschlossen habe, obwohl mich der Klappentext eigentlich nicht wirklich angesprochen hat. Um es vorweg zu nehmen: Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen, denn einmal mehr kann ich die allgemeine Begeisterung nicht teilen.
Schon der Beginn des Buches sorgt für Irritation. Nach einem kurzen Abriss über Meridians Kindheit und Jugend, in dem man erfährt, dass die Außenseiterin seit ihrer Geburt den Tod anzieht und in ihrer Gegenwart ständig Tiere sterben, beginnt die eigentliche Story mit Meridians sechzehnten Geburtstag. Just an diesem Tag wird das Mädchen in einen Autounfall verwickelt und von ihren merkwürdigen und völlig überforderten Eltern aus dem Haus geschafft: Ausgestattet mit einem Brief ihrer Mutter, der mindestens ebenso viele Fragen aufwirft wie er beantwortet, wird sie in einen Bus nach Colorado verfrachtet, der sie zu ihrer Tante Merry bringen soll, die sie noch nie zuvor getroffen hat. Nach einigen Schwierigkeiten dort angekommen, erfährt sie nach langem Hin und Her, dass sie eine Fenestra ist, ein Wesen, das Sterbende in den Himmel zum Schöpfer begleitet. Wo es die Guten gibt, gibt es natürlich auch die Bösen – in diesem Fall in Gestalt der Aternocti, die nicht nur versuchen, die sterbenden Seelen in die Hölle zum Zerstörer zu bringen, sondern die darüber hinaus die Fenestrae töten oder auf die Seite des Bösen ziehen wollen. Die verständlicherweise völlig überforderte Meridian muss also nicht nur lernen, Menschen auf die andere Seite zu begleiten, ohne selbst Schaden dabei zu nehmen, sie muss sich auch noch für den Kampf gegen die Aternocti wappnen.
Das Mädchen kann einem wirklich leid tun – und zwar nicht nur wegen dem, was da auf sie einstürzt, sondern auch wegen des unsinnigen Verhaltens ihrer Verwandtschaft. Da lassen ihre großartigen Eltern sie – trotz besseren Wissens – sechzehn Jahre lang in dem Glauben, sie sei verantwortlich für den Tod all der in ihrer Nähe verstorbenen Tiere, statt ihr vielleicht mal zu erklären, dass sie diese nicht tötet, sondern ihnen hilft. Es lehrt sie auch keiner, besser mit ihrer Begleiteraufgabe umzugehen, sodass ihr das Sterben der Tiere keine Schmerzen und schlaflosen Nächte bereitet. Und es bereitet sie auch keiner darauf vor, dass sie an ihrem sechzehnten Geburtstag die Familie verlassen muss und ab diesem Tag auch menschlichen Seelen beim Übertritt zu helfen hat. Warum um alles in der Welt hat niemand sie vorher mit ihrer Tante Merry, ebenfalls eine Fenestra, bekannt gemacht, damit sie aufgeklärt und vernünftig auf ihre neue schwierige Aufgabe vorbereitet werden kann? Und das, obwohl von vornherein klar ist, dass »die Tante« – wie sie die meiste Zeit über völlig unpersönlich genannt wird – zum Zeitpunkt von Meridians Geburtstag nur noch wenige Tage zu leben hat und mitnichten ausreichend Zeit hat, ihrer Nichte alles Notwendige beizubringen? Selbst bei Tante Merry angekommen, wird Meridian aus unerfindlichen Gründen über vieles im Dunklen gelassen und mit dem lapidaren Hinweis abgespeist, sie müsse lernen, Vertrauen zu schöpfen und tun, was ihr gesagt wird. Das alles macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn und ist ein gravierender logischer Mangel.
Unausgegoren ist auch der Aternocti-Plot. Es scheint ja offenbar von vornherein festzustehen, dass das Mädchen, sobald sie 16 Jahre alt ist, von den Schergen des Zerstörers gejagt werden wird. Warum die Aternocti den Geburtstag überhaupt abwarten, ist unklar; wären sie schlau, würden sie Meridian schon vorher ausschalten, dann müssten sie sich nicht mit einer »vollwertigen« Fenestra herumschlagen. Immerhin waren die Aternocti, die sich u.a. verantwortlich zeichnen für den Untergang der Azteken, von Atlantis und den Osterinseln (von denen ich noch gar nicht wusste, dass sie überhaupt untergegangen sind!), so weise, sich in der Stadt anzusiedeln, in der Tante Merry und nun eben auch Meridian leben. Sie treten ausgerechnet in Gestalt eines abgrundtief bösen Sektenführers in Erscheinung, der seiner Kirchengemeinde mittelalterliche Vorstellungen einimpft und sie mit seiner Bösartigkeit vergiftet. Die 106 Jahre alte und eigentlich sehr erfahrene Tante steht den Aternocti dummerweise vollkommen hilflos gegenüber. Sie ist einem solchen Wesen nie wissentlich begegnet und hat keine Ahnung, wie man sich ihnen zur Wehr setzen kann. Immerhin gibt sie Meridian einen überaus weisen Vorschlag an die Hand: Sie soll ein paar andere Fenestrae fragen, vielleicht können die helfen. Es bleibt ihr Geheimnis, warum sie sich nicht mal vorher um das Problem gekümmert hat, nachdem doch klar war, dass Meridian gejagt werden würde – wahrscheinlich war auch ihre Zeit vor lauter Steppdeckennähen knapp, so wie auch der Mutter die Zeit ausgegangen ist, ohne dass sie ihrer Tochter etwas erklären konnte.
In Anbetracht des unverantwortlichen Verhaltens ihrer Umwelt braucht es einen ja schon nicht mehr zu wundern, dass auch Meridian seltsam ist. Sie nimmt die Trennung von ihrer Familie über weite Strecken ebenso klaglos hin wie den drohenden Tod ihrer Tante, der sie zu allem Übel auch noch beim Übertritt ins Jenseits helfen muss, wie sie erfährt. Meridians Handlungsmotive sind mir oft unklar, und sie ist mir nicht sehr sympathisch; teilweise wirkt sie seltsam starr und emotionslos, teilweise extrem kindlich. Letzteres liegt nicht nur an ihrer Begeisterung für den mehrfach erwähnten Sponge-Bob-Flanellschlafanzug, sondern auch an ihren Umgang mit dem Jungen Tens und an ihrer unauthentischen Ausdrucksweise. Welche Sechzehnjährige würde denn bitte »Was wird hier gespielt?« (S. 143) fragen, wenn die Tante in heller Panik zur Schrotflinte greift, oder vor Überraschung »Ach du heiliger Strohsack?« (S. 306) rufen?! Das ist einfach nicht glaubwürdig und passt ebenso wenig wie die keusche Liebesbeziehung zum geheimnisvollen Tens, der vielleicht ihr Wächter oder ein Kriegerengel ist, vielleicht aber auch nicht, und dessen Schicksal irgendwie mit Meridians verknüpft ist.
Kann man über die Logikmängel und die Dialoge und Handlungen, die nur bedingt Sinn machen, hinwegsehen, lässt sich das Buch ganz nett weglesen; nett sind vor allem einige Szenen mit Tante Merry, die ein hohes Maß an Geborgenheit vermitteln. Alles in allem plätschert die Geschichte ohne große Höhen und Tiefen und ziemlich spannungsarm vor sich hin, wozu auch der wundersame »Endkampf« passt, der denkbar unspektakulär und ohne echtes Zutun der reichlich blass geratenen Hauptpersonen vonstatten geht, die märchenhafterweise unverhoffte Hilfe erhalten.
Fazit:
5/15 – Eine nicht wirklich glaubwürdige Protagonistin irrt durch ein halbgares Buch. Ein Jammer um die tolle und außergewöhnliche Grundidee! Die Fortsetzung, an der die Autorin derzeit arbeitet, werde ich ganz sicher nicht lesen.
Originaltitel: Evermore
The Immortals, Book 1
 
Inhalt:
Ever ist sechzehn Jahre alt, als sie ihre gesamte Familie bei einem Autounfall verliert – sie überlebt als Einzige. Seither ist sie in sich gekehrt und kapselt ihre verletzte Seele von der Außenwelt ab. Alles ändert sich jedoch, als sie Damen zum ersten Mal in die Augen blickt. Denn Damen sieht nicht nur verdammt gut aus, er hat etwas, was Ever zutiefst berührt. Aber irgendetwas an ihm irritiert sie. Seitdem sie dem Tod so nahe war, besitzt sie nämlich die einzigartige Fähigkeit, die Gedanken der Menschen um sie herum hören und ihre Aura sehen zu können. Doch nicht so bei Damen: Er scheint diese Gabe auf mysteriöse Weise außer Kraft zu setzen. Sie sieht und hört nichts – für sie ein untrügliches Zeichen, dass Damen eigentlich tot sein müsste. Er wirkt aber alles andere alles leblos, und am liebsten würde Ever sich nie mehr von seinem warmen Blick lösen. Wenn sie sich nur nicht ständig fragen müsste, wer er eigentlich ist und was er ausgerechnet von ihr will …
Kommentar:
Eigentlich fängt das Buch sehr vielversprechend an, denn Ever erscheint zunächst als ziemlich außergewöhnliche Heldin. Sie kann seit einem Unfall, an dem sie sich die Schuld gibt und bei dem sie ihre Familie verloren hat, nicht nur Geister, sondern auch die Aura anderer Menschen sehen und deren Gedanken hören. Dass ihre hellseherischen Fähigkeiten eher Nachteile mit sich bringen, wird direkt zu Beginn des Buches klar, als Ever mit ihrer Freundin Haven zusammen ist und unter Havens Berührung leidet. Das hübsche Mädchen verschanzt sich also hinter Kapuzenpullovern und lauter Musik, um die Umwelt möglichst auszuschalten. Alles ändert sich, als der attraktive Damen an der Schule auftaucht, denn wenn er sie berührt oder mit ihr redet, herrscht auf einmal wunderbare Stille um sie herum. Gegen ihren Willen verliebt sie sich in ihn und ist glücklich, als er ihre Gefühle zu erwidern scheint – obwohl sie weiß, dass irgendetwas nicht mit ihm stimmt.
Aus dieser prinzipiell guten Grundidee macht die Autorin leider ein wenig erbauliches Buch. Die Figuren sind viel zu platt und klischeehaft, allen voran der geheimnisvolle, (be-)zaubernde, charmante, überwältigend gutaussehende und scharfe, allwissende und künstlerisch begabte, allseits beliebte, von allen begehrte Damen – kann man nicht vielleicht mal ein bisschen weniger dick auftragen?!
Nicht viel besser sind Evers beste bzw. einzige Freunde: Miles ist schwul und für die Bühne geboren, Haven ein rebellierender Goth und zudem extrem zickig und albern. Beide sind in Damen verliebt, wobei Haven sogar so weit geht, ihn sich zu »reservieren«. Was man zunächst für einen Scherz halten könnte, ist toternst gemeint, wie Ever feststellen muss, als Damen sein Interesse an ihr deutlich macht, denn Haven wendet sich von ihr ab und sucht sich eine andere Freundin, zunächst Evangeline, dann Drina. Drina allerdings ist das personifizierte Böse – und das ist auch allen klar außer Haven.
Ever selbst erscheint zunächst interessant und relativ vernünftig, doch das ändert sich mit zunehmendem Fortschreiten der Handlung. Schon ihre erste Reaktion auf Damen – ihre vehemente Weigerung, ihn anzusehen –, ist seltsam, doch mit zunehmender Verliebtheit werden ihre Verhaltensweisen und Beweggründe immer weniger nachvollziehbar. Und zwar nicht nur hinsichtlich Damen, sondern auch was ihr eigenes Leben angeht.
Angesichts dieser Figuren ist natürlich auch in Sachen Story nicht mehr viel zu retten. Um genau zu sein, nach einem recht starken Beginn macht sich ziemlich schnell Langeweile breit, obwohl durchaus viel passiert – wenn auch nichts von Bedeutung. Damen verführt Ever z.B. permanent zum Schule schwänzen, um spannende Dinge wie einen Besuch in Disneyland, beim Pferderennen oder am Strand zu unternehmen. Das Ende solcher Ausflüge kommt immer ziemlich abrupt, indem sich Damen nämlich stets aus unerfindlichen Gründen in Luft auflöst; Ever wundert sich zwar darüber, übt sich aber weitgehend in Ignoranz und begnügt sich mit Damens halbherzigen Erklärungen. Das Grundproblem des Buches dürfte sein, dass alles, was passiert, relativ belanglos ist und einfach aneinandergereiht und runtergeschrieben wirkt, ohne dass irgendein Gefühl rüberkommt.
Wirklich richtig ärgerlich ist das letzte Drittel des Buches – ab dem Moment, wo Ever erfährt, wieso sie den Unfall damals überlebt hat und beginnt, sich mit Wodka (der übrigens als »süße Flüssigkeit« bezeichnet wird) abzuschießen, weil sie zufällig gemerkt hat, dass sie so ihre hellseherischen Fähigkeiten ausschalten kann. Die Handlung zieht sich ab diesem Punkt trotz all der (teils hanebüchenen) Aufklärungen und der Action am Ende wirklich wie Kaugummi; ein Übermaß an Infos, Kniffen und Wendungen wirkt ab einem gewissen Punkt eben eher ermüdend als spannend! Zudem muss man sich angesichts der gelieferten Informationen und Erklärungen doch fragen, wie die ganze vorherigen Ereignisse überhaupt passieren konnten und wieso Damen nicht eher gehandelt hat; vieles erscheint nicht ganz logisch und konsequent zu Ende gedacht worden zu sein. Und gerade, als man glaubt, dass es schlimmer nicht mehr werden kann, zaubert die Autorin auch noch die ultimativ lachhafte Idee aus dem Hut: Es kommt zu einem Mord im 4. Chakra und zu Heilung durch Selbstvergebung. Also bitte!
Fazit:
05/15 – Jede Menge Plattitüden, viel Langeweile, eine ziemlich haarsträubende Auflösung und ein signifikanter Mangel an Gefühl – einmal mehr wurde aus einer guten Grundidee viel zu wenig herausgeholt. Schade drum.
Originaltitel: McKettrick’s Luck
Die McKettricks, Teil 1
 
Inhalt:
Jesse McKettricks Herz schlägt für das weite Land, das seine Vorfahren einst urbar gemacht haben, für die Ranch, auf der er lebt und arbeitet. Nichts kann ihn von hier vertreiben. Doch dann kommt die schöne Cheyenne Bridges nach Indian Rock und mit ihr die größte Herausforderung seines Lebens. Denn Cheyenne soll ihn im Auftrag ihres Bosses mit Charme und notfalls auch List dazu bringen, einen Teil seines Lands abzugeben. Jesse brennt vor Leidenschaft. Aber das Erbe seiner Vorfahren an eine Immobiliengesellschaft verkaufen? Niemals. Stattdessen schmiedet er einen Gegenplan, der seine Widersacherin von dem wilden Zauber der Natur und der unbegrenzten Freiheit überzeugen soll und von seiner Liebe.
Kommentar:
Ich mag Liebesromane. Wirklich! Sie dürfen auch ein bisschen kitschig und notfalls sogar ein bisschen pathetisch sein. Die Betonung liegt aber auf »ein bisschen«. Was hier geboten wird, ist des Guten zu viel, und zwar bei weitem.
Die Geschichte ist austauschbare Standardkost: Cheyenne wird von ihrem Chef in ihre alte Heimatstadt geschickt, um dem reichen Rancher Jesse McKettrick Land abzuschwatzen. Da er in Geld schwimmt und sein Land liebt, lehnt er das lukrative Angebot ab, doch Cheynenne bleibt weiter dran – nicht zuletzt, weil sie das Honorar, das sie bei diesem Deal verdient, dringend zur Unterstützung ihrer Familie braucht. Im Laufe der Handlung verlieben sich Cheyenne und Jesse, der Leser kriegt ganz nebenbei ein wenig Poker-Nachhilfe, und am Ende wird natürlich alles gut.
So eine Story kann nur durch gelungene Figuren zu etwas besonderem werden, und tatsächlich – sie sind gar nicht schlecht! Die weibliche Protagonistin Cheyenne ist vielleicht eine Spur zu selbstmitleidig, überfürsorglich, unentschlossen und wenig zupackend, geht aber letztendlich in Ordnung. Mit der männlichen Hauptfigur, Jesse McKettrick, hat Linda Lael Miller allerdings einen wirklich tollen Helden geschaffen, er ist ein bisschen Macho, ein bisschen raubeiniger Cowboy, ein bisschen Romantiker – alles in allem ein wirklich ansprechender Typ, der weiß, was er will und um das, was er will, kämpft.
Unter diesen Voraussetzungen hätte aus »So frei wie der Himmel« prinzipiell vielleicht kein überragendes, aber zumindest ein gutes, unterhaltsames Buch werden können – wären da nicht diese riesige Ansammlung von Klischees und das überbordende Pathos, das z.T. fast schon esoterisch anmutet. Einen ersten Höhepunkt von Millers Welt erlebt man, als Jesse McKettrick Cheyenne das Land zeigt, das sie erwerben will. Schon als sie sich auf dem Rücken ihrer edlen Rösser auf zur Besichtigung machen, ahnt man, dass gleich Dramatisches passieren wird, denn Cheyenne betet aus unerfindlichen Gründen: »Oh bitte, lass mich das Land nicht zu sehr lieben.« (S. 58) Wie sie überhaupt auf die Idee kommt, sie könne das Land zu sehr lieben, bleibt ihr Geheimnis; ist aber auch egal, denn natürlich bleibt es bei dem frommen Wunsch: Als das Landstück, um das es geht, in ihr Blickfeld gerät, wird sie von einer wahren Disneyidylle überwältigt: »Tausende von Bäumen. Sonnenbeschienene Wiesen, auf denen Wild graste. Ein geschwungener Bach funkelte wie die Quasten an den Tambourstöckchen bei Cora’s Curl and Twirl.« (S. 62) Man kann die zwitschernden Vögelchen und fröhlich flatternden bunten Schmetterlinge in dieser Szenerie förmlich vor sich sehen und erwartet fast das Auftauchen des letzten Einhorns! Doch auch ohne Einhorn ist Cheyenne sehr ergriffen. »Tränen stiegen ihr in die Augen. Wieder begann dieser dumpfe Trommelschlag in ihrem Blut zu dröhnen und vibrierte durch ihre Venen« (S. 62), »Die Schönheit des Landes schien auf ihren ureigensten Rhythmus zu antworten wie ein riesiges unsichtbares Herz« (S. 65). Doch auch Jesse, dem sein Land ja eigentlich hinreichend bekannt sein sollte, ist ganz hingerissen: »Ehrfürchtig nahm Jesse den Hut ab, als ob er eine Kirche betreten hätte. Sein Gesicht sah plötzlich ganz anders aus, als ob er das Land nicht nur mit den Augen in sich aufnahm, sondern mit jeder einzelnen Pore seines Körpers.« (S. 63)
Leider ist die Ergriffenheit aller Anwesenden über die glorifizierte Schönheit des Landes nicht der einzige Auslöser für maßloses Pathos. Angereichert mit irrsinnigen Übertriebungen und gesteigert durch verstärkende Wiederholungen übertrifft sich die Autorin immer wieder aufs Neue selbst und versetzt selbst abgebrühte Leser in Erstaunen:
»So wild er [Jesse] auch war, so sehr besaß er daneben eine angeborene und vollkommen widersprüchliche Ruhe. Als kreiste er um einen inneren Kern, der direkt mit der Unendlichkeit des Seins verbunden war. Wie es wohl wäre, mit einem Mann wie ihm zu schlafen? Einem Mann, der sich derartig elementar konzentrieren konnte?« (S. 96)
»Aber für einen kurzen Moment wollte sie nicht länger Cash Bridges‘ Tochter sein. Nicht die verlässliche Stütze ihrer Mutter. Nicht Mitchs Beschützerin. Sie wollte nur eines sein. Nur eines.
Eine Frau.
Eine Frau aus Fleisch und Blut, die sich einem Mann aus Fleisch und Blut hingab. Wen scherten schon die Konsequenzen?« (S. 198)
»Bestimmt hätten sie fantastischen Sex, eine atomare Verschmelzung, aber selbst solche Verschmelzungen kühlten mit der Zeit ab.« (S. 199)
»Wahrscheinlich lag ihr auf der Zunge, dass es nicht zu viel bedeutete, dass der Sex fantastisch gewesen war. Dass sie beide schließlich erwachsen wären. Ähnliche Gedanken hatte er auch gehabt – bis zu dem Moment, in dem Cheyenne ihn an Orte führte, von denen er niemals zu träumen gewagt hätte. Sie hatte ihm die Landschaft seiner eigenen Seele gezeigt, mit der Sonne und dem Schatten, den Schluchten, Bergen und verschlungenen Flüssen.« (S. 214)
Und als wäre das nicht ohnehin schon des Guten zu viel, müssen wir auch noch über ein Schlafzimmer lesen, dessen Decke freskenmäßig mit Cowboys und Rinderherden bemalt ist, und philosophischen Gedanken über das Leben und nebeineinander existierende unterschiedliche Zeitdimensionen folgen. Wie Cheyenne und eine Schwester von Jesse feststellen, verlaufen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nämlich nicht etwa linear, sondern alles geschieht gleichzeitig. Und weil sich diese Zeitdimensionen manchmal überschneiden, kann man hie und da Leute aus der Vergangenheit/Zukunft treffen (vgl. S. 249f.).
Die Übersetzung trägt auch nicht gerade zum Lesevergnügen bei. Das fängt mit Kleinigkeiten wie nicht hundertprozentig treffenden Wörtern an – zum Beispiel »bürstet« man Pferde nicht, sondern striegelt sie! – und endet bei der kompletten Ignoranz des Plusquamperfekts. Und letzteres nervt richtig, denn es ist zum Teil richtig sinnentstellend und verwirrend. Hinzu kommt, dass in manchen Szenen verbindende Sätze zu fehlen scheinen, wie in folgender Szene, in der Cheyenne Zähneputzen will und Jesses Bad aufsucht. »Cheyenne fand mehrere verpackte Zahnbürsten. Schließlich hatte sie sich bei Lucky’s übergeben.« (S. 205) Nicht, dass man es nicht im Kontext trotzdem verstehen würde, aber es lässt einen stutzen und ist nicht wirklich sauber. Ob derartige Auslassungen allerdings aus dem Original kommen, oder erst bei der Übersetzung passiert ist, weiß ich nicht; sie tragen jedenfalls nicht zur Qualität des Buches bei.
Fazit:
6/15 – Ein Buch, das eigentlich hätte nett sein können, wenn es nicht unter dem ganzen Kitsch erstickt wäre.
Originaltitel: The Bride Hunt
Duncan Sisters, Book 2
 
Inhalt:
Die drei adligen Schwestern Prudence, Constance und Chastity, Herausgeberinnen des Suffragettenmagazins »The Mayfair Lady«, bezichtigen in ihrem Blatt Lord Barcley des sexuellen Missbrauchs seiner weiblichen Angestellten sowie betrügerischer finanzieller Machenschaften. Als ihnen daraufhin eine Verleumdungsklage ins Haus flattert, ist die Sorge groß, denn hieb- und stichfeste Beweise für ihre Anschuldigungen haben sie nicht. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an den Anwalt Sir Gideon Malvern, der für seine außerordentlichen Fähigkeiten im Gerichtssaal gerühmt wird und im Ruf steht, auch schwierige Fälle gewinnen zu können. Obwohl er den Fall der Schwestern für ziemlich aussichtslos hält, lässt er sich von Prudence überzeugen, ihn trotzdem anzunehmen, denn die rothaarige Schönheit hat auch sein privates Interesse geweckt …
Kommentar:
»Die perfekte Braut« ist zwar der zweite Teil einer Trilogie um drei Schwestern, kann aber problemlos ohne Kenntnis des ersten Bandes gelesen werden, in dem die älteste Schwester Constance unter die Haube kommt. Diesmal wird die vernünftige Prudence an den Mann gebracht: an den reichen Anwalt Sir Gideon, der die Verleumdungsklage abschmettern soll. Doch die Vorzeichen stehen alles andere als gut, denn Gideon hält die Lord Barcleys Klage für gerechtfertigt und empört sich in typisch männlicher Manier über die vermeintlich haltlosen Anschuldigungen. Nur weil Prudence sein privates Interesse weckt und es außerdem schafft, ihn bei seiner Ehre zu packen, übernimmt er schließlich den Fall mit dem Ziel, nicht nur die Verleumdungsklage abzuwenden, sondern darüber hinaus eine Schadensersatzklage gegen Lord Barclay anzustrengen. Als Honorar dafür verlangt er die Anwaltskosten und sowie 80 Prozent der Schadensersatzsumme. Die praktisch veranlagte Prudence, die auf jeden Cent angewiesen ist, um den Lebensunterhalt der verarmten Familie zu bestreiten, ist von der 80:20-Regelung alles andere als begeistert und setzt nach einigen Diskussionen ihren Gegenvorschlag durch: Die Schwestern, die ganz nebenbei eine Kontaktservice betreiben, dürfen versuchen, eine Frau für den geschiedenen Anwalt zu finden. Gelingt ihnen dies, erhalten sie die komplette Schadensersatzsumme; haben sie keinen Erfolg, erhält der Anwalt seine 80 Prozent. Obwohl der Anwalt gar keine Frau sucht, lässt er sich auf diesen absurden Vorschlag ein.
Kaum sind damit die Rahmenbedingungen für den Roman geschaffen, macht sich Langeweile breit. Der Fall wird in allen möglichen Gesprächskonstellationen immer wieder durchgekaut (Prudence mit Gideon, Prudence mit der jüngeren Schwester Chastity, Prudence mit der älteren Schwester Constanze, Prudence mit beiden Schwestern, Prudence mit beiden Schwestern und dem Schwager usw.), darüber hinaus verbringt Prudence natürlich jede Menge Zeit damit, in jedem passenden und unpassenden Moment Gideon mit trampeligen Fragen bzgl. Ex- sowie seiner Wunschgattin zur Weißglut zu bringen; nicht mal nach einer gemeinsam verbrachten heißen Nacht kann sie es lassen. Warum sollte sie auch, sie beharrt ja darauf, kein Interesse an Gideon zu haben – außer vielleicht sexuell. Komischerweise gefällt es ihr dennoch nicht besonders, als die Ex-Frau ihres Liebhabers unvermittelt ins Haus schneit. Überhaupt wird es an dieser Stelle ziemlich abstrus, denn zunächst überredet Prudence den unwilligen Gideon, seiner armen Ex-Frau Quartier zu gewähren; kaum hat sie ihn davon überzeugt, beendet sie die Affäre aber mit der Begründung, dass man ja nun nicht einfach so weitermachen könne wie bisher, wo seine Ex-Frau im Haus lebt. Dieser Kniff soll wohl die Spannung und Dramatik kurz vor Ende noch mal anheben!
Jane Feather erzählt extrem weitschweifig und detailverliebt. Man wird den Eindruck nicht los, dass sie sich wahnsinnig viel Wissen über die spätviktorianische Zeit angelesen hat, dieses aber auch unbedingt loswerden muss. Da werden gerne auch mal gleich drei für ein Rendezvous zur Auswahl stehende Kleider hinsichtlich Farbe, Material, Schnitt, Spitze, Knöpfe bis ins letzte Detail beschrieben, ebenso wie Speisen und deren Geschmack, Menüs und Zubereitungen. Banalitäten wie z.B. dem Tranchiervorgang oder dem sorgfältigen Entkorken einer Weinflasche wird dabei ausreichend – um nicht zu sagen: mehr als genug! – Platz eingeräumt. Hinzu kommt sinnloses ausuferndes Namedropping berühmter zeitgenössischer Autoren (inklusive zahlreicher Zitate, die unsere schlaue Heldin selbstverständlich aus dem FF kennt) sowie einer Vielzahl von Weinensorten, von denen ich noch nie gehört habe.
Ganz ehrlich: Ich finde es toll und wichtig und richtig, dass sich auch Autorinnen »seichter« historischer Liebesromane mit der Zeit, über die sie schreiben, ernsthaft auseinandersetzen, aber dieses Hintergrundwissen sollte eher dazu dienen, den Zeitgeist zu verstehen und einzufangen – und nicht auf Teufel komm raus weitervermittelt werden. Feathers Vorgehen wirkt einfach wahnsinnnig bemüht. Im Zusammenhang mit dem korrekten historischen Kontext frage ich mich außerdem, wie wahrscheinlich es ist, dass Prudence ohne »Not« und nicht mal aus Liebe, sondern aus reiner sexueller Neugierde ihre Jungfräulichkeit geopfert hat. Frauenrechtlerin hin oder her, sie ist eine Adlige im ausgehenden 19. Jahrhundert; ein potentieller Ehemann hätte das in dieser Zeit kaum mit Begeisterung aufgenommen.
Die Übersetzung von Anke Koerten wirkt teils holprig, etwas antiquiert und hat mich mehrfach stutzen und so manch einen Satz zweimal lesen lassen. Für die blumig-metaphorische Vergleiche bei den Liebesszenen muss man aber wohl die Autorin selbst verantwortlich machen – einmal mehr begegnet uns z.B. die immer wieder bemühte Woge der Lust, die im Innern unserer liberalen Heldin zu einem Brecher (!) anschwillt, sich überschlägt und schließlich ausläuft. Fällt denen nicht mal was Neues ein?
Fazit:
5/15 – Ein sehr durchschnittliches Buch, das so austauschbar und unbedeutend ist, dass ich bereits nach zwei Tagen nicht mehr wusste, was eigentlich passiert ist und fürs Schreiben des Kommentars noch mal reinlesen musste.
Originaltitel: Lament. The Faerie Queen’s Deception
The Books of Faerie, Teil 1
 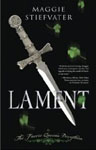
Inhalt:
Immer wieder träumt die 16-jährige Deirdre von einem geheimnisvollen Jungen namens Luke. Doch das sind nur Träume, oder? Das Mädchen kann es kaum glauben, als ihr Luke bei einer Schulaufführung plötzlich leibhaftig gegenübersteht. Noch seltsamer wird es, als ihre Großmutter sie eindringlich vor dem Jungen warnt und sie bittet, sich von ihm fernzuhalten. Das ist längst unmöglich für Deirdre: Sie hat sich unsterblich verliebt. Doch Luke ist nicht der, für den sie ihn hält. Als er plötzlich spurlos verschwindet und Deirdre sich auf die Suche nach ihm macht, gerät sie mitten hinein in einen magischen Krieg, der seit Jahrhunderten währt. Und sie erfährt, dass der Junge, den sie liebt, von der rachsüchtigen Feenkönigin mit einem ganz bestimmten Auftrag zu ihr geschickt wurde: Um sie zu töten …
Kommentar:
Diese Geschichte hat (fast) alles, was ein klassisches Märchen ausmacht: einen Kampf zwischen Gut und Böse, einen Helden mit tragischem Schicksal, der gerettet werden muss, übernatürliche Wesen, aufopferungsvolle Helfer und eine große Liebe. Die märchenhaften Züge manifestieren sich aber auch in einem Umgang mit dem Übernatürlichen, der von Beginn an äußerst befremdlich wirkt.
Hauptperson Deirdre – wohlgemerkt im 21. Jh. lebend! – nimmt mit stoischer Gelassenheit die seltsamen Vorgänge und das absonderliche Verhalten ihrer Umgebung zur Kenntnis: Sie wundert sich weder über das Auftauchen eines Jungen aus ihren Träumen noch über voyeuristische sprechende Kaninchen, geschweige denn über ihre eigenen plötzlich aufkeimenden übernatürlichen Fähigkeiten. Auch dass ihre Großmutter undurchsichtige Gespräche mit dem eigentlich fremden Jungen führt und sich überhaupt ihre ganze Familie auf einmal vollkommen merkwürdig verhält, hinterfragt sie ebenso wenig wie die ständigen rätselhaften Bemerkungen ihres neuen Freundes Luke, mit dem sie sich seltsam verbunden fühlt. Sie hat ja schließlich mit ihrer frisch entflammten Liebe wahrlich genug zu tun, da kann sie sich nicht zusätzlich um derartige Abstrusitäten kümmern! Sporadisch aufkeimende Zweifel und Fragen werden von Luke ganz easy zerstreut, etwa mit dem Vorschlag: »Schmoll nicht, sing lieber!« (118). Sorgen wegmuszieren bzw. -singen – wer wollte sich in Anbetracht von Deirdres Ignoranz und Verdrängungstalent darüber noch ernsthaft aufregen?!
Es wird besser, als Deirdre an einem gewissen Punkt der Handlung nicht mehr länger ignorieren kann, was um sie herum vorgeht, und wenigstens in groben Zügen über die Lage aufgeklärt wird. Doch selbst dann ist Mangel an Neugier und ihr nicht vorhandener Drang, näheres zu erfahren und alles verstehen zu wollen, noch vorhanden und nicht nachvollziehbar. Sie scheint ganz nach dem Motto zu handeln: Was ich nicht weiß, betrifft mich auch nicht – ich stolper einfach weiter blauäugig durch die Welt und hoffe drauf, dass meine Freunde, Glück und der Zufall es schon richten werden. Märchenhaft, eben. Vielleicht aber auch einfach Ausdruck des (missglückten) Versuchs der Autorin, die Spannung zu steigern, indem sie den Leser so lange wie möglich im Dunklen tappen lässt.
Da Deirdre so erfolgreich die Realität verdrängt, der Leser das Geschehen aber aus ihrer Perspektive erlebt, erfährt man über das Opfer ihrer Begierde zunächst herzlich wenig. Luke ist gutaussehend, blond, fürsorglich, spielt hinreißend Flöte und schreckt ganz offensichtlich nicht vor kotzenden Mädchen zurück. Da er gerne mal vor sich hinorakelt, mit rätselhaften Bemerkungen verblüfft und immer wieder unvermittelt aus dem Nichts auftaucht, um Deirdre zu retten, wirkt er zwar einigermaßen mysteriös, ist dabei aber nicht wirklich überzeugend. Ansonsten ist er vor allem sprachlich auffällig, wenn er Sätze wie »Weine nicht, hübsches Mädchen« (S. 64) oder »Nun, komm denn, meine frostige Königin« (S. 60) äußert. (Muss ich erwähnen, dass Deirdre sich nicht daran stört, geschweige denn verwundert ist?) Wie man später erfährt, hat Luke einen durchaus interessanten Hintergrund, der auch seine antiquierte Sprache erklärt, leider hat die Autorin aber verpasst, sein Schicksal gut genug auszuarbeiten, sodass auch er letztendlich blass bleibt.
Eine weitere wichtige Person ist James, Deirdres bester Freund. Er ist das genaue Gegenteil von Luke, Typ Klassenkasper, immer nen lässigen Spruch auf den Lippen (der oft nicht wirklich lustig ist). Er wirkt zunächst normal, zuverlässig und bodenständig, offenbart dann aber unvermittelt hellsichtige Fähigkeiten, streckt heroisch böse mächtige Feen nieder und wundert sich ebenso wenig über die seltsamen Vorgänge wie Deirdre selbst. Warum er am Ende in dieser Form mit in die Geschichte gezogen werden muss, erklärt sich mit dem just erschienenen Buch, in dem James zum Protagonisten mutiert.
Die Grundidee von Lament ist nicht sensationell neu, aber so einfach wie gut. Die Geschichte an sich ist faszinierend und hat großes Potenzial, sie ist aber schlicht und ergreifend nicht gut, sondern vollkommen oberflächlich umgesetzt – und zwar nicht nur wegen Deirdres befremdlicher und unglaubwürdiger Ignoranz, sondern auch wegen des Handlungsaufbaus insgesamt. Vieles bleibt im Dunklen, vieles ist nur angedeutet, verworren dargestellt und/oder nicht konsequent zuende gebracht. Regelmäßig sorgen überflüssige Kursivierungen für Verärgerung und Szenen, in denen Deirdre Situationen mit den Augen anderer sieht, für Verwirrung, weil sie so übergangslos ins Geschehen integriert wurden. Zudem spielen sich immer wieder für die Handlung elementare Ding so nebenbei ab, dass sie völlig untergehen; erst später fällt einem auf, dass man offenbar irgendwas verpasst haben muss, das in einem Nebensatz abgehandelt wurde. Ich hab wirklich selten so oft zurückgeblättert und Passagen mehrfach gelesen – und stand am Ende dennoch mit so vielen unbeantworteten Fragen da.
Fazit:
5/15 – Aus der Idee hätte man ein wunderbares Buch machen können, leider ist die Umsetzung ziemlich misslungen. Es passiert zu viel zu schnell, ohne dass man den Sinn, geschweige denn den Gesamtzusammenhang erfassen könnte. Am Ende stehen jede Menge offene Fragen und eine Lösung, die auch nicht gerade dazu beiträgt, einen mit der Geschichte zu versöhnen.
Originaltitel: Evernight
1. Teil der Evernight-Academy-Serie
 
Inhalt:
An jedem Ort wäre Bianca lieber als an diesem: Das Evernight-Internat ist eine Eliteschule, und die anderen Schüler sind einfach zu perfekt – zu clever, zu schön, zu rücksichtslos. Bianca weiß, dass sie niemals dazugehören wird, und reißt aus. Doch sie soll nicht weit kommen. Noch auf dem Gelände der Schule läuft sie Lucas in die Arme. Der junge Mann ist ebenso ein Einzelgänger wie sie, und er ist anscheinend fest entschlossen, das auch zu bleiben. Bianca merkt sehr schnell, dass es eine besondere Verbindung zwischen ihr und Lucas gibt, eine Anziehungskraft, die jedes normale Maß übersteigt. Doch sie muss auch erkennen, dass Lucas von dunklen Geheimnissen umgeben ist. Von Geheimnissen, die alles in Frage stellen, woran Bianca jemals geglaubt hat …
Kommentar:
Schwierig, »Evernight« zu kommentieren, ohne die zwei Wendungen zu verraten, von denen das Buch lebt, daher fass ich mich kurz. Das Buch erzählt einmal mehr eine Teenie-Geschichte mit Vampir, die auf einem Internat spielt. Die Schule wird – wie es scheint – im Wesentlichen von irgendwie privilegierten Jugendlichen besucht, die die weniger privilegierten Neuen nicht gerade mit Begeisterung aufnehmen. Die Handlung verläuft zunächst ziemlich zäh und man weiß nicht recht, worum es geht und was das alles soll, weil die Autorin vorrangig damit beschäftigt ist, ein Geheimnis daraus zu machen, was in der Evernight Academy los ist. Dass mit dieser Schule irgendwas nicht stimmt, ist offensichtlich, zumal Protagonistin Bianca und einige weitere neue Schüler das Internat mehrfach als unheimlich und einschüchternd bezeichnen. Weshalb dieses Gefühl sie umtreibt, wird leider zu keinem Zeitpunkt deutlich – und was Bianca angeht, macht das ungute Gefühl ohnehin keinen rechten Sinn, wie sich später herausstellt.
Spannung bezieht die Handlung aus der ersten echten Überraschung im Handlungsverlauf, die allerdings zeigt, dass der Leser die ganze Zeit von der Autorin bewusst in die Irre geführt wurde. Der eine oder andere mag das faszinierend und tricky finden, ich konnte solche Kniffe aber noch nie leiden – aber das ist wirklich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Dass später eine zweite nicht vorhersehbare Wendung bemüht wird, macht die Sache für mich logischerweise nicht besser. Da das Buch aber wie angesprochen im Wesentlichen von diesen beiden sensationellen Enthüllungen lebt, bleibt für mich nicht mehr viel, was mich begeistern könnte. Probleme mit Eltern, Lehrern und Freunden, Beziehungssorgen und Liebesschwüre von Teenies sind ohnehin nicht (mehr) so wirklich mein Thema; wenn all das dann aber auch noch inhaltlich wie sprachlich oberflächlich und banal präsentiert wird wie hier geschehen, dann reicht das einfach nicht. Hinzu kommt, dass sich die Handlungsmotive der Figuren nicht erschlossen haben und dass ich die Geschichte teils als unlogisch und unausgegoren empfunden habe.
Ein weiteres Manko des Buchs sind die Hauptpersonen Bianca und Lucas. Nicht nur sind ihre Handlungsmotive nicht nachvollziehbar, sie sind auch noch beide ziemlich blass und alles andere als Sympathieträger. Bianca wirkt trotz ihrer 16 Jahre extrem naiv und ist entsprechend begeisterungsfähig; ihre augenblickliche völlige Fixierung auf Lucas ist einigermaßen anstrengend. Da wundert es schon nicht mehr, dass sie Pläne für eine goldene Zukunft schmiedet und Liebes- bzw. Zusammengehörigkeitsbeteuerungen äußert, die bei mir teilweise wirklich Fremdschämen auslösen. Lucas ist nicht ganz so anstrengend, aber leider nicht weniger farblos. Seine versuchte Darstellung als Schläger und Aufrührer einerseits und Biancas Beschützer andererseits ist nur bedingt glaubwürdig, und sein gesamtes Gebahren passt zum Teil überhaupt nicht zu den Enthüllungen des Buches.
Fazit:
6/15 – Nicht ganz so schlimm, wie es (vielleicht) klingt, aber einfach nicht so wirklich mein Thema, um mich gut zu unterhalten. Die Fortsetzung würde ich mir trotz des einigermaßen offenen Endes wohl eher nicht kaufen. Ich sollte vielleicht wirklich aufhören, Young-Adult-Bücher zu lesen. Andererseits: Twilight hat mir schließlich auch gefallen – die Bücher müssen einfach nur was haben!
|
 Inhalt:
Inhalt:




















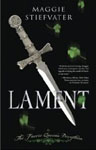


Neueste Kommentare